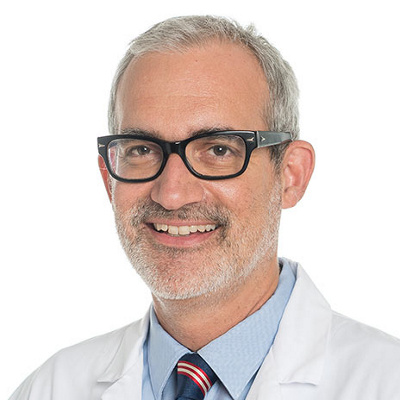Ein Oberschenkelbruch, medizinisch Femurfraktur, ist eine schwere Verletzung des Oberschenkelknochens (Femur) und wird meist chirurgisch behandelt. Je nach Lage und Ausprägung des Bruchs erfolgt die Stabilisierung der Fraktur mithilfe von Platten, Schrauben oder Nägeln. In bestimmten Fällen – insbesondere bei schweren oder gelenknahen Brüchen – kann auch der Einsatz einer Hüftprothese notwendig sein.

Femurfrakturen im Überblick
Femurfrakturen können verschiedene Abschnitte des Oberschenkelknochens betreffen: vom Oberschenkelkopf (Oberschenkelkopffraktur) über den Oberschenkelhals (Schenkelhalsfraktur) und Oberschenkelschaft (Femurschaftfraktur) bis hin zum Bereich nahe dem Kniegelenk (distale Femurfraktur).
Am häufigsten treten Oberschenkelhalsbrüche auf – typischerweise bei älteren Menschen mit Knochenschwund (Osteoporose), etwa nach einem Sturz zur Seite. Selten sind auch jüngere Patientinnen und Patienten betroffen, meist infolge von Hochrasanztraumata wie Verkehrsunfällen oder schweren Sportverletzungen.
Behandlungsziel
Das Ziel der Femurfraktur-Operation ist die rasche Wiederherstellung der Stabilität, Beweglichkeit und Gehfähigkeit des Patienten oder der Patientin. Je nach Art der Fraktur wird der Bruch durch Osteosynthese – also die Fixierung mit Platten, Schrauben oder Marknägeln – oder durch den Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks behandelt.
Ablauf der Operation
Die Wahl der Operationsmethode hängt sowohl von der genauen Lokalisation der Fraktur als auch vom allgemeinen Gesundheitszustand der Patientin oder des Patienten ab. Der Eingriff erfolgt entweder in Vollnarkose oder unter Rückenmarksanästhesie (Spinalanästhesie).
Im Rahmen der Operation wird der Oberschenkelknochen im Bereich der Bruchstelle freigelegt, der Bruch sorgfältig ausgerichtet und die Knochenfragmente in richtiger Position fixiert. Je nach Frakturtyp kommen dabei unterschiedliche Verfahren zum Einsatz – etwa Metallplatten, Marknägel, dynamische Hüftschrauben oder spezielle Nägel für den oberen (proximalen) Teil des Oberschenkels.
Ist aufgrund einer ausgeprägten Trümmerfraktur oder eines fortgeschrittenen Knochenschwundes nicht genügend stabiles Knochenmaterial vorhanden, kann körpereigenes Knochengewebe – beispielsweise aus dem Hüftknochen – entnommen und transplantiert werden.
Bei schweren, hüftgelenknahen Femurfrakturen – wie etwa Hüftkopf- oder Oberschenkelhalsbrüchen – kann insbesondere bei älteren Patientinnen und Patienten der Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks (Endoprothese) notwendig sein.
Zum Abschluss der Operation wird häufig eine Drainage gelegt, um Wundflüssigkeit kontrolliert abzuleiten. Danach wird die Wunde verschlossen. Die Dauer des Eingriffs liegt – abhängig vom Verfahren – in der Regel zwischen ein und zwei Stunden.
Vorbereitung & Vorsorge
Vor der Operation wird die genaue Lage sowie der Verlauf der Fraktur mithilfe von Röntgenaufnahmen bestimmt. In komplexeren Fällen kann zusätzlich eine Computertomografie erforderlich sein, um den Bruch detaillierter beurteilen zu können.
Im Vorfeld des Eingriffs erfolgen die üblichen präoperativen Untersuchungen, darunter eine Blutuntersuchung, die Blutdruckmessung sowie ein EKG. Blutverdünnende Medikamente müssen in Absprache mit dem behandelnden Arzt rechtzeitig abgesetzt werden. Zudem ist es wichtig, vor dem operativen Eingriff nüchtern zu bleiben – das heisst, mindestens sechs Stunden vorher nichts mehr zu essen und zwei Stunden vorher nichts mehr zu trinken.
Nachsorge & Genesung
Bereits kurz nach dem Eingriff beginnt die physiotherapeutische Mobilisation, um die Beweglichkeit zu fördern und Komplikationen vorzubeugen. Die eingelegten Drainageschläuche werden in der Regel nach ein bis zwei Tagen entfernt. Postoperative Schmerzen werden gezielt mit geeigneten Schmerzmitteln behandelt.
Während des etwa sechstägigen Spitalaufenthalts wird das schrittweise Gehen mit Teilbelastung an Gehhilfen geübt. Bis zur vollständigen Heilung nach ca. 6 bis 8 Wochen darf das Bein jedoch nicht voll belastet werden. Der Heilungsverlauf wird durch regelmässige Nachkontrollen überwacht.
Implantate wie Schrauben oder Platten, die im Rahmen der Osteosynthese eingesetzt wurden, verbleiben meist im Körper und müssen nur entfernt werden, wenn sie Beschwerden verursachen.
Mögliche Komplikationen
Operationen bei Oberschenkelbrüchen gelten insgesamt als risikoarm und verlaufen in der Regel ohne schwerwiegende Komplikationen. Wie bei jedem chirurgischen Eingriff lassen sich gewisse Risiken jedoch nicht vollständig ausschliessen. Dazu zählen unter anderem Infektionen, Nachblutungen, Blutgerinnsel oder in seltenen Fällen Verletzungen von Nervenstrukturen. Ebenfalls selten kann es zu einer eingeschränkten Beweglichkeit des Hüftgelenks kommen und besonders bei älteren Patientinnen und Patienten besteht das Risiko, dass sich die Gehfähigkeit nach dem Eingriff nicht vollständig wiederhergestellt wird.
Fragen rund die Behandlung eines Oberschenkelbruchs
Muss eine Femurfraktur immer operiert werden?
Häufig ist ein operativer Eingriff notwendig, um eine stabile Heilung und rasche Mobilisierung zu ermöglichen. Nur bei sehr stabilen nicht verschobenen Brüchen oder bei Patientinnen und Patienten mit hohem Operationsrisiko kann auch eine konservative Behandlung in Erwägung gezogen werden.
Wie lange dauert die Genesung nach einem Oberschenkelbruch?
Die Heilungsdauer nach einem Oberschenkelbruch beträgt meist etwa sechs bis acht Wochen. Bei komplexeren Frakturen oder älteren Menschen kann sich die Genesung entsprechend verlängern. Wie rasch die volle Mobilität wiedererlangt wird, hängt stark vom individuellen Gesundheitszustand und von der durchgeführten Rehabilitation ab.
Wie lange bleibt man nach einer Oberschenkelbruch-Operation im Krankenhaus?
Der stationäre Aufenthalt nach einer Oberschenkelfraktur dauert normalerweise zwischen fünf und sieben Tagen. Im Anschluss folgt in der Regel eine Rehabilitationsphase – entweder ambulant oder stationär – um die Mobilität gezielt wiederaufzubauen.
Wann darf man nach einem Oberschenkelbruch wieder Auto fahren?
Das Autofahren nach einer Oberschenkelfraktur ist erst wieder erlaubt, wenn die Beinbelastung schmerzfrei möglich ist und eine ausreichende Reaktionsfähigkeit besteht – in der Regel frühestens 6 bis 8 Wochen nach der OP. Eine ärztliche Freigabe ist empfehlenswert.
Wie lange ist man nach einem Oberschenkelbruch arbeitsunfähig?
Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit nach einer Oberschenkelfraktur hängt von Beruf, Bruchtyp und Heilungsverlauf ab. Bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten kann die Arbeitsunfähigkeit mehrere Monate dauern, während eine Rückkehr zu Büroarbeiten unter Umständen bereits nach wenigen Wochen möglich ist.
Zentren 20
-
Endoclinic Zürich
Witellikerstrasse 40(Eingang Enzenbühltrakt) 8032 Zürich -
Hüftzentrum
-
Ortho Clinic Zürich
Montag - Freitag
8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr